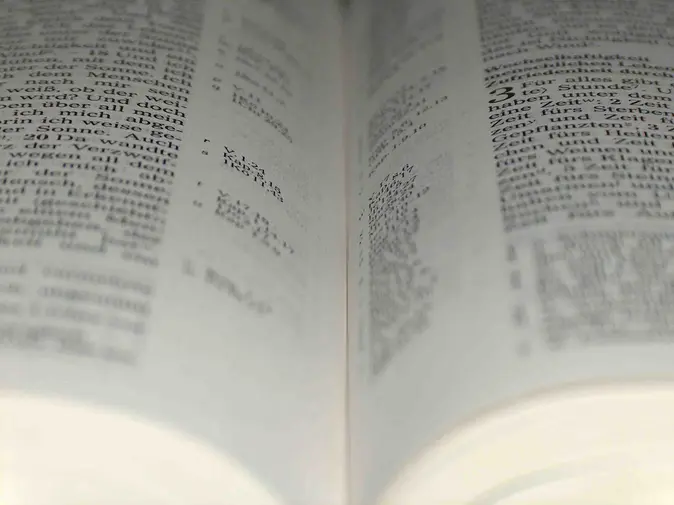Prof. Dr. Klaus Bieberstein zeigt auf, dass sich beispielsweise der Monotheismus des Alten Testamentes in einem langen Prozess entwickelte. (Bild: Pixelquelle)
Der lange Weg zum Monotheismus
Als ein Forschungsprojekt von beträchtlicher gesellschaftlicher Relevanz bezeichnete Wolfgang Thierse im November 2004 das damals neu eröffnete Bamberger Zentrum für Interreligiöse Studien (ZIS). Im Rahmen eines Studiengangs und zahlreicher Veranstaltungen versuchen Theologen, Judaisten, Islam- und Gesellschaftswissenschaftler Brücken zwischen ihren Disziplinen zu schlagen. Vor wenigen Jahrzehnten sei ein solches Studienprogramm noch völlig undenkbar gewesen, meinte Prof. Dr. Klaus Bieberstein, Lehrstuhlinhaber für Alttestamentliche Wissenschaften an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Am 20. Oktober 2005 eröffnete er mit einem Vortrag, der den Weg zum Monotheismus beschrieb, die diesjährige ZIS-Ringvorlesung „Einführung in die Heiligen Schriften“.
Verstehensgrundlage der Heiligen Schriften
Seinen Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung begann Bieberstein mit der Unterscheidung von primären und sekundären Religionen. Primäre Religionen zeichnen sich dadurch aus, so Bieberstein, dass sie meist polytheistisch in ein religiöses Symbolsystem einer Gruppe eingebunden sind, das mit der Religion einer Nachbargruppe übertragbar ist: „So existieren Keilschriftwörterbücher, in denen die Namen von Göttern einer Religion mit ihren Äquivalenten in einer anderen übersetzt werden“, vermerkte Bieberstein. Sekundäre Religionen hingegen haben oft Stifterpersönlichkeiten, oder -gruppen. Ihre Angehörigen setzen sich durch ihren Monotheismus von den primären Religionen ab und bergen, so Bieberstein, ein gewaltiges Konfliktpotential. Und doch haben die drei großen monotheistischen Weltreligionen vieles gemeinsam: „Die frühen Christen verstanden sich als Teil eines stark pluralistischen Judentums“, erklärte Bieberstein, „wie sich auch die frühen Muslime keineswegs als dritte Gruppe neben Juden und Christen sahen.“ Auch wenn der Islam das nicht immer so sehen würde, bemerkte Bieberstein, könne man sich die jüngeren Heiligen Schriften nicht ohne die älteren denken. Somit lasse sich das Alte Testament als Verstehensvoraussetzung aller späteren Heiligen Schriften bezeichnen.
Der Text, der, so Bieberstein, etwa das Ausmaß von 20 tapetengroßen Rollen habe, beschreibt die Geschichte von Erschaffung der Welt bis zur Zeit der Perser bzw. in den Makkabäerbüchern die Zeit des Hellenismus. „Wir müssen uns klar machen, dass das Alte Testament die darin beschriebenen Vorgänge Jahrhunderte später aus der Retrospektive festhält“, merkte Bieberstein an. Zwar wurden Chronologien erstellt, in denen Ereignisse in biblischen Zeiten genau datiert wurden, doch schon ab dem Jahr 1000 vor Christus fallen Ungereimtheiten auf. Bieberstein verglich die Chronologie der „Erzählung Altes Testament“ und die kulturgeschichtliche Überlieferung mit einem Reißverschluss: „Alles was vor 1000 war, ist nicht mehr koordinierbar.“ Als anschauliches Beispiel führte er die Händlerkarawane an, an die der biblische Joseph von seinen Brüdern verkauft wurde: Die Erzählung setzt Josephs Vater Jakob fast zweitausend Jahre vor unserer Zeitrechnung an. Das Dromedar hingegen wurde erst im 12. Jahrhundert vor Christus domestiziert und ab dem 10. erst als Lasttier genutzt.
Nicht vom Himmel gefallen
Mit zahlreichen Dias beschrieb Bieberstein dann, wie sich die alttestamentliche Glaubenswelt vom Polytheismus zum Eingottglauben entwickelte: „Man muss den Weg zum Monotheismus nicht diskreditieren, aber buchstäblich vom Himmel gefallen ist der Glaube an einen Gott keineswegs“, meinte Bieberstein. Er zeigte auf, dass sich der Monotheismus in einem langen Prozess erst entwickelte, in der Volksfrömmigkeit und in der Kunst lebte der Polytheismus deutlich länger fort, als das Alte Testament uns das glauben machen will: Zahlreiche Inschriften sprechen von „YHWH und seiner ’Ashera“. Im polytheistischen Pantheon sei dem männlichen Gott El diese Partnerin ’Ashera zugeordnet. Von El zum Elohim, dem Gottesnamen im Alten Testament, sei es, so Klaus Bieberstein, kein weiter Weg. Später heiße es dann „YHWH durch seine ’Ashera“. Die weibliche Göttin wird also vielmehr zu einer Eigenschaft des Hauptgottes YHWH. Nach einer radikalen Kultreform im Jahre 622 v. Chr. werde ’Ashera dann zu einem Feindbild, gegen das auch im Alten Testament polemisiert werde, so der Bamberger Theologe. In dem einen Gott seien viele Aspekte zentriert und kombiniert, auch die weiblichen Züge einer ’Ashera. Dass das Abwerten anderer Gottheiten auch heute noch existiere, zeige sich gut am Beispiel des Islam, meinte Bieberstein. Vielen sei nicht bewusst, dass Allah letztlich nichts anderes bedeute als al-Lah, der Gott. „So ist der Weg noch lange nicht zu Ende“, so Bieberstein.
Weitere Termine der Ringvorlesung
Einführung in das Neue Testament (Prof. Dr. Lothar Wehr)
10.11. Entstehung und literarische Eigenart der neutestamentlichen Schriften
17.11. Die paulinischen Briefe und ihre theologische Bedeutung
24.11. Die Jesusverkündigung der Evangelien
Einführung in die nachbiblischen Schriften des Judentums (Dr. Alexander Deeg)
01.12. Schriftliche & mündliche Tora: Heilige Schriften im Judentum
08.12. Haggada & Halacha: Ein grundlegender Wechselschritt rabbinischer Schriftauslegung
15.12. Formen rabbinischer Schriftauslegung und ihre hermeneutische Brisanz
22.12. Eine andere „art“ der Auslegung: Midrasch bei den Rabbinen und seine gegenwärtige Entdeckung
Einführung in den Koran (Prof. Dr. Rotraud Wielandt)
12.01. Der Koran: Hauptthemen – Besonderheiten der Textgestalt – Textgeschichte
19.01. Der Koran im Glauben und Leben der Muslime: Islamisches Offenbarungsverständnis – die Rolle koranischer Texte in Kultus und religiöser Alltagskultur
07.02. Klassische und moderne Verfahren der Koranexegese und ihre hermeneutischen Grundlagen
Abschließende Podiumsdiskussion
09.02. Die Heiligen Schriften im Gespräch