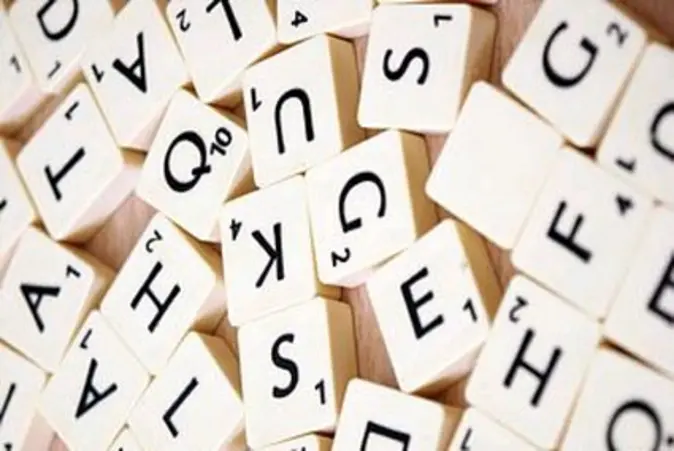Kommunikation braucht verlässliche Sprachzeichen. Aber wie kam es zu einer Ordnung, wie wurde der "Tanz der Symbole" gebändigt? (Bild: Photocase)
Wo kommt also die Sprache her? Manfred Bierwisch aus Berlin gab erste Antworten (Bild: Martin Rucker)
Der Tanz der Symbole
In diesem Semester veranstaltet das Bamberger Zentrum für Wissenschaftliche Weiterbildung (ZeWW) eine Vortragsreihe, die von Neuronenfeuer und Sprachengewirr handelt. Neun Expertinnen und Experten betrachten das Thema „Kommunikation und Neurowissenschaften“ aus ihrer jeweiligen Perspektive.
Wie die Sprache die Welt berechnet
Den Auftakt gestaltete am 21. November Prof. Dr. Manfred Bierwisch von der Humboldt-Universität zu Berlin mit seinem Vortrag „Tanz der Symbole – Wie die Sprache die Welt berechnet“.
Die einleitende These des Linguisten besagt, dass die gesprochene Sprache ein Produkt der biologischen Evolution des Menschen ist. Erst der aufrechte Gang führte zur Freilegung des Kehlkopfbereichs und somit zu einer verbesserten Vokalisationsfähigkeit. Der „Tanz der Symbole“ ist als Metapher zu verstehen: Mit dem Repertoire an verbindlichen Zeichen – nichts anderes sei die Sprache – erfasst und berechnet der Mensch seine Umwelt, ihre Objekte und Signale. Nach Charles Peirce existieren hier drei Kategorien, das „Ikon“, das „Index“ und das „Symbol“. Dies veranschaulichte Bierwisch an verschiedenen Zeitmessgeräten. Das Signal einer Sanduhr sei ein „Index“, da eine direkte Kausalbeziehung zwischen der Menge des Sandes und der verbliebenen Zeit bestehe.
Ein Ziffernblatt mit Zeigern ist nach Bierwisch ein „Ikon“. Kulturhistorisch entwickelte sich die Zeiteinteilung in zwei mal 12 Stunden, das vorher erlernte Ablesen der Zeiger ermöglicht die Orientierung innerhalb dieses Zeitablaufes. Eine Digitalanzeige ist dementsprechend ein „Symbol“, da eine allgemeine Konvention die sofortige Deutung erlaubt.
Symbolkombinatorik
Erst durch seine Bewegung in dem ihm umgebenden Raum, durch seine Beziehungen zu anderen Menschen und Objekten und durch seine Sinnestätigkeit erschafft der Mensch seine eigene Begriffsstruktur. Zur Verfeinerung seiner Sprache ist zusätzlich die Symbolkombinatorik erforderlich, also das Verbinden verschiedener Teilstrukturen zu größeren Einheiten. Jeder Schritt, der auf einen anderen folgt, ergibt eine Wegstrecke, die größer als der einzelne Schritt ist. „Ein gewöhnlicher Stadtplan ist nichts anderes als eine Ansammlung an vereinheitlichten Ikonen, die der Interpret mit gewissen Vorinformationen leicht entschlüsseln kann“, argumentierte Bierwisch.
Zum Ende seines Vortrages ergänzte der Referent das Zitat von Wittgenstein „Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“. Da sich nicht alle Phänomene einer entsprechenden Begrifflichkeit unterordnen ließen, sei es vermessen den Anspruch zu erheben, mit Sprache alles erfassen zu können. Die Grenzen der Sprache fallen demnach nur im Falle einer allumfassenden begrifflichen Kategorisierung mit den Grenzen der Welt zusammen. Und das sei schwer vorstellbar.
Der nächste Vortrag findet am Mittwoch, den 29. November, um18:00 Uhr im Raum F384 in der Feldkirchenstraße statt. Prof. Dr. Hans-Michael Straßburg vom Universitätsklinikum Würzburg wird über neuropädiatrische Aspekte bei Sprachentwicklungsstörungen im Kindesalter referieren.
Das Bamberger Zentrum für Wissenschaftliche Weiterbildung (ZeWW) ist eine interdisziplinäre Einrichtung für wissenschaftliche Erwachsenenbildung. Das Zentrum veranstaltet unter anderem Vortragsreihen und Ringvorlesungen zu den verschiedensten Themen. Weitere Informationen und die nächsten Termine finden Sie 1>[hier...]