Laufende Projekte
StoryPharm - Storytelling as Pharmakon
Storytelling as Pharmakon in Premodernity and Beyond: Training the New Generation of Researchers and Professionals in Health Humanities (StoryPharm)
Laufzeit: September 2024
Projektförderung:
Projektleitung: Prof. em. Dr. Ingrid Bennewitz
Projektmitarbeitende: Prof. Dr. Gesine Mierke, Julis Dünninger, B.A.
Zuordnung / Einrichtung: ZeMas
Projektbeschreibung:
Nach dem erfolgreichen Abschluss des EU-Horizon 2020 Projekts NetMAR (gemeinsam mit der Universität Zypern und der University of Southern Denmark) ist dem Zentrum für Mittelalterstudien nunmehr die nächste erfolgreiche Bewerbung um ein großes EU-Projekt gelungen. Der Vorschlag mit dem Titel „Storytelling as Pharmakon in Premodernity and Beyond: Training the New Generation of Researchers in Health Humanities“ („StoryPharm“) wurde im Rahmen der wettbewerbsorientierten Maßnahme „Marie Skłodowska-Curie: Doctoral Networks“ (HORIZON-MSCA-2023-DN-01) eingereicht, die Teil des Programms Horizon Europe 2021–2027 ist.
Das Projekt, das im September 2024 angelaufen ist, verfügt über ein Gesamtbudget von 4,1 Millionen Euro, davon über 1,2 Millionen Euro für die Universität Bamberg. StoryPharm erhielt eine der höchsten Punktzahlen (98,5 %) auf der Grundlage von Kriterien wie wissenschaftlicher Exzellenz und innovativer Methodik des vorgeschlagenen PhD-Programms. Damit ist das ZeMas Teil eines innovativen, interdisziplinären Projekts in den Geistes- und Kulturwissenschaften, das antike und mittelalterliche Ansätze zu körperlichen und geistigen Krankheiten sowie die therapeutische Rolle von Erzählungen untersucht. Zum Netzwerk von StoryPharm gehören fünf europäische Universitäten (die Universität Zypern, die das Projekt leitet, Bamberg, Lund, Salerno und Cardiff) und sieben weitere Institutionen (AVVA Pharmaceuticals Ltd - Zypern, Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH, Verlag Walter de Gruyter, Staatsbibliothek Bamberg, Erzdiözese Bamberg, Germanisches Nationalmusem und The David Collection in Dänemark).
Link zur Homepage:
https://www.ucy.ac.cy/storypharm/

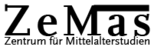
DFG-Projekt: Altsächsisch multimedial. Digitale und philologische Neuerschließung der kleineren Texte (9.-12. Jh.)
Laufzeit: 01. Oktober 2023 - 30.September 2026
Projektförderung: DFG
Projektleitung: Prof. Dr. Norbert Kössinger
Projektmitarbeitende: Dr. des. Pia Schüler
Projektpartner / Kooperation: in Zusammenarbeit mit der UB Heidelberg.
Zuordnung / Einrichtung: Lehrstuhl für Deutsche Philologie des Mittelalters (Universität Bamberg)
Projektbeschreibung:
Nach heutigem Kenntnisstand sind vom 9. bis zum Ende des 12. Jahrhunderts 23 kleinere Prosa- und Verstexte in altsächsischer Sprache überliefert. Doch in keiner der bisherigen Ausgaben sind alle Texte versammelt worden. Die letzte, heute jedoch in weiten Teilen überholte Edition mit textkritischen Apparaten, Anmerkungen und Glossar legte Elis Wadstein 1899 vor, einzelne Texte sind darüber hinaus in Elias von Steinmeyers Ausgabe von 1916 ediert. Seither haben sich jedoch nicht nur die Editionsstandards verändert und entwickelt, sondern es sind zudem weitere Textzeugen entdeckt worden, die bei Wadstein 1899 und von Steinmeyer 1916 noch nicht enthalten sind. Auf der Grundlage des skizzierten Forschungsstands ist somit derzeit ein Zugriff auf die kleineren altsächsischen Texte als zusammengehöriges und zeitgemäß aufgearbeitetes Korpus nicht möglich. Das Projekt ‚Altsächsisch multimedial‘ strebt eine grundlegende Neuerschließung des Gegenstandsbereichs in einer methodisch innovativen Verbindung von digitaler Aufbereitung und ‚klassischem‘ philologischem Handwerkszeug an: In einem Onlineportal wird das Textkorpus in Kooperation mit der Universitätsbibliothek Heidelberg in Transkriptionen und Editionen mit paläographisch-kodikologischen, textkritischen sowie forschungs- und editionsgeschichtlichen Apparaten und in hochwertigen Farbdigitalisaten der gesamten Textüberlieferung neu zugänglich gemacht. Alle altsächsischen Texte werden zusätzlich in neuhochdeutschen, englischen und italienischen Übersetzungen sowie – erstmals überhaupt – professionell eingesprochen als Audioaufnahmen zur Verfügung gestellt. Jeder Text wird zudem durch eine Einführung und einen Stellenkommentar inhaltlich auf dem aktuellen Stand der Forschung vorgestellt und erschließbar gemacht. Als Komplement zur Onlineerschließung wird ‚Altsächsisch multimedial‘ das edierte Textkorpus als Buchpublikation (Printausgabe sowie E-Book als Open Access) veröffentlichen. Die frühesten Zeugnisse volkssprachiger Kultur in niederdeutscher Sprache aus der Karolinger-, Ottonen- und Salierzeit werden so gemäß aktuellen Standards für Forschung und Lehre verfügbar gemacht, auch über den engeren Kreis der Frühmittelaltergermanistik hinaus.

DFG-Netzwerk: Lautsphären des Mittelalters
Laufzeit: 2021 - 2025
Projektförderung: DFG
Projektleitung:
- Prof. Dr. Gesine Mierke: Inhaberin der Professur Germanistische Mittelalterforschung mit Schwerpunkt Digital Humanities (Universität Bamberg)
- Prof. Dr. Martin Clauss: Inhaber der Professur Geschichte Europas im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit (TU Chemnitz)
Zuordnung / Einrichtung: Professur für germanistische Mittelalterforschung (Universität Bamberg)
Projektbeschreibung:
Das Netzwerk nimmt sich der Lautsphären mittelalterlicher Gesellschaften und den Methoden ihrer Erforschung an. Hinweise auf Laute finden sich zahlreich in den verschiedensten Quellengattungen, und sie belegen, wie wichtig es ist, diese Dimension der Epoche zu erschließen. Die methodischen Herausforderungen dieses Unterfangens ergeben sich nicht nur aus der Beschaffenheit flüchtiger Laute, sondern aus einer spezifischen Quellenlage, die von sehr unterschiedlichen Transformationsprozessen vom Laut hin zu dessen Medialisierung geprägt ist. Diese Prozesse variieren von Gattung zu Gattung und können sich auch quer zu Gattungs- und Disziplinengrenzen abspielen. Daher genügt es nicht, das Thema ausschließlich in den Bahnen einer Geschichte des Hörens zu konzeptionalisieren. Vielmehr will das Netzwerk der disziplinären Vielschichtigkeit des Phänomens gerecht werden und aus den Perspektiven der beteiligten Disziplinen in den Blick nehmen, welche Auswirkungen die verschiedenen Formen der Medialisierung von Lauten auf ihre Repräsentation und Funktion haben. Im Ganzen erfährt der Aspekt des Hörens methodische Erweiterung, die als Grundlage des interdisziplinären Dialogs dienen soll. Diese zielt auf die beiden großen Komplexe ‚Medialität/Intermedialität‘ und ‚akustische Räume‘ – beiden ist je eine große Fachtagung gewidmet. Gerade an den Schnittstellen verschiedener Medien – wie etwa zwischen Schrift und Bild oder Notation und Architektur – erweist sich die Brisanz des Themas Lautsphären. Gleiches gilt für die Überlappungszonen verschiedener, akustisch oder teilweise akustisch konzipierter Räume.

Interdisziplinäres Lehr- Lernprojekt „Digitales Edieren: Die Schlacht zu Mühldorf“
Laufzeit: WS 21/22 - 2025
Projektförderung:
Projektleitung: Prof. Dr. Gesine Mierke, Universität Bamberg, Prof. Martin Clauss, TU Chemnitz
Projektpartner / Kooperation: Das Projekt entsteht in Kooperation mit dem Geschichtszentrum Mühldorf am Inn: https://www.museum-muehldorf.de/
Projektmitarbeitende: Studierende der Universität Bamberg und derTU Chemnitz
Zuordnung / Einrichtung: Professur für Germanistische Mittelalterforschung
Projektbeschreibung: Am 28.09.1322 standen sich bei Mühldorf (östlich von München) Ludwig IV., der Bayer, und Friedrich der Schöne im Kampf um die Krone des römisch-deutschen Reiches gegenüber. Ludwig ging als Sieger aus der Auseinandersetzung hervor, Friedrich der Schöne geriet in Gefangenschaft. Die Schlacht, die oftmals als ‚letzte deutsche Ritterschlacht‘ bezeichnet wird, war ein wichtiger Wendepunkt im Thronstreit und ebnete den Weg für die unangefochtene Herrschaft Ludwigs IV.
Die Quellenlage ist vergleichsweise günstig und dennoch von zahlreichen Herausforderungen geprägt. Zu den interessantesten Quellen zählt der sogenannte „Streit von Mühldorf“, der zahlreiche auch kulturhistorisch interessante Details überliefert. Bislang wurde dieser Text jedoch noch nicht hinreichend beforscht.
Das Lehr-Lernprojekt, das in Zusammenarbeit der Fachbereiche Mittelalterliche Geschichte (Prof. Martin Clauss, TU Chemnitz) und Germanistische Mediävistik (Prof. Dr. Gesine Mierke, Universität Bamberg) entsteht, hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit Studierenden eine digitale Edition sowie eine Buchedition des „Streits von Mühldorf“ zu erstellen. Im Projekt, das sich über mehrere Semester fortgeführt wird, werden Handschriften transkribiert, ein normalisierter Text erstellt, übersetzt und ein interdisziplinärer Kommentar erarbeitet.
Bei Interesse wenden Sie sich gern an Martin Clauss (martin.clauss@phil.tu-chemnitz.de) oder Gesine Mierke (gesine.mierke@uni-bamberg.de)
Compendium Sonicum
Projektförderung: gefördert aus Mitteln des Forschungspauschalenbudgets der TU Chemnitz
Zuordnung / Einrichtung: Professur für Germanistische Mittelalterforschung
Projektbeschreibung:
Anschubfinanzierung für eine Datenbank zu akustischen Phänomenen des Mittelalters,
Link zur Homepage:
